Ingeborg Krölke
Als Kind prügelte sie sich mit Jungs und sprang über Eisschollen – heute vertraut Ingeborg Krölke (76) auf Buddha und meditiert mehrmals am Tag. Ihre wahre Liebe fand sie vor fast 30 Jahren in ihrem Beruf: 1989 eröffnete sie ihr eigenes Kosmetikgeschäft mit Fußpflege in Berlin-Moabit und kann sich seitdem nichts Schöneres mehr vorstellen.
Ingeborg Krölke reckt sich mit ihren 1,56 m Körpergröße so hoch sie kann. Der große Kerl, der sie um Kopfeslänge überragt, hat gerade ihre Geldkassette vom Tresen genommen und denkt, sie hätte das nicht gesehen. Wütend greift sie ihm vorn in sein T-Shirt und dreht den Stoff inklusive seiner Brusthaare in ihrer Faust. „Stellste die die Dose wieder hin oder soll ich zuschlagen?“ Ihre Augen sind dabei fest auf ihn gerichtet. Dann wird ihr plötzlich bewusst, wie absurd das wirken muss – diese kleine wütende Frau, die dem Mann noch nicht einmal zur Schulter reicht, aber keine Angst vor ihm hat. Doch sie dreht das T-Shirt nur noch fester in ihrer Hand. Natürlich könnte der Dieb sie einfach beiseite schieben, aber das ist ihr jetzt egal. In ihrem Geschäft wird nicht geklaut. Basta! Und tatsächlich: Ihre Entschlossenheit zeigt Wirkung. Kleinlaut stellt der Mann die Geldkassette wieder auf ihren Platz und verlässt das Geschäft. Bei Ungerechtigkeiten lässt Ingeborg Krölke so schnell nicht locker. Damit bekam sie schon in der Schule Ärger, wenn sie sich für Mitschüler einsetzte.
Wilde Jugend
Als Ingeborg 1941 in Werder geboren wird, ist ihr Vater gerade seit drei Jahren an Land. Der Seemann hatte sich in Ingeborgs Mutter Margot verliebt und dann für sie der See den Rücken gekehrt. Sein Fernweh muss er jedoch seiner Tochter Ingeborg mitgegeben haben, denn die macht sich mit fünf Jahren mit ihrem kleinen Handkarren auf, um die Welt zu erkunden. Das kleine Mädchen läuft mehrere Kilometer weit, bis sie eine Nachbarin vor der Glindower Dorfkirche heulend findet und auf dem Gepäckträger wieder nachhause bringt. „Meine Mutter war heilfroh, denn die hatte schon verzweifelt die Havel abgesucht.“
Als sie älter wird, entwickelt sich das Einzelkind immer mehr zu einem Wildfang. Angst kennt sie keine. Sie ist wild und impulsiv. „Wenn es hieß ‚trauste dich?‘, war ich immer dabei,“ erinnert sie sich lachend. Sie klettert auf Bäume, schleicht sich in Nachbargärten, um Birnen zu klauen und prügelt sich mit Jungen, um sich als einziges Mädchen durchzusetzen. Fasziniert vom Roman „Onkel Toms Hütte“ spielt sie mit den Nachbarjungen die Fluchtszene der jungen Sklavin im Roman nach. „Bei uns auf der Havel hatten die Fischer das Eis aufgehackt, um zu angeln. Kaum waren die weggegangen, sind wir auf die Eisscholle gesprungen und dann prompt eingebrochen.“ Die Fischer müssen Ingeborg und ihre Freunde aus dem eiskalten Wasser ziehen. „Ich bekam dann zweimal Senge. Einmal von dem Fischer, der mich rausgezottelt hat und als ich nachhause kam nochmal.“
Da sich ihr Vater kurz nach ihrer Geburt freiwillig zur Armee gemeldet hat, wächst Ingeborg mit ihrer Mutter und der Großmutter auf. „Meine Mutter hat oft zu mir gesagt, ,du bist wie meine Mutter!’, und das klang nicht freundlich“, sagt Ingeborg Krölke und lacht. Ihre braunen Augen funkeln dabei verschmitzt über den Goldrand ihrer Brille hinweg. Sie trägt ihr blondiertes Haar kurz, aber gerade so lang, dass es ihre beiden Hörgeräte überdeckt. Ihr weißer Kittel und die weißen Handschuhe hätten bei jemand anderem vielleicht streng gewirkt. Doch Ingeborg Krölke strahlt so viel Fröhlichkeit aus, dass man meint, man blicke direkt in die Augen eines jungen Mädchens.
„Meine Mutter war ein schickes Ding, groß und schlank und immer knallrote Fingernägel. Sie konnte nicht kochen, nicht backen, aber fuhr Auto und konnte Klavier spielen.“ In das von Ingeborgs Großeltern gepachtete Kino „Lindenpalast“ in Werder kommen damals oft bekannte Schauspieler zu den Vorführungen. Elegant gekleidet blüht die Mutter bei diesen Treffen förmlich auf. „Sie war wie ein Pfau im Hühnerhof,“ sagt Ingeborg Krölke kichernd und zupft die Finger eines Gummihandschuhs zurecht.
Trennung vom Vater
Doch nach dem Krieg ist alles anders. Die Vorführgeräte sind demontiert und das Kino geschlossen. Werder gehört nun zur russischen Besatzungszone und das Leben ist alles andere als fröhlich. Als der Vater 1945 aus dem Krieg zurückkehrt, beginnt der jedoch für die Menschen im Ort Musik zu machen. Der große, dunkelhaarige Mann lässt viele den düsteren Alltag vergessen, wenn er voller Lebensfreude Schifferklavier spielt, Step tanzt oder Shantys auf Englisch singt. Dies ist den Russen allerdings ein Dorn im Auge. Sie zwangsverpflichten ihn für die Bergwerksarbeit in Aue, von wo er bald danach in den Westen flüchtet. „Meine Mutter fuhr dann manchmal rüber zu ihm mit Wodka und kam mit grüne Heringe zurück. Das war damals ein begehrter Artikel,“ sagt Ingeborg Krölke mit dem typischen Berliner Dialekt, der keinen Dativ kennt.
1947 nimmt ihre Mutter sie einmal mit zu ihrem Vater, der mittlerweile in Hamburg wohnt. Als Bürger der sowjetischen Besatzungszone können sie nur illegal mit Schleusern über die schwach bewachte grüne Grenze in die Westzone außerhalb Berlins. Auf dem Hinweg geht alles gut, aber auf dem Rückweg werden sie von den Russen gestellt und verhaftet. Nach drei Tagen in einem Lager und einem Stempel im Reisepass, wagen sie es nicht, die Grenze noch einmal zu passieren – die Familie ist somit getrennt.
Ab 1948 wird auch in Westberlin die DMark der Westzone eingeführt. So gibt es plötzlich zwei Währungen in der Stadt. Schnell ist die Westmark doppelt soviel wert wie die unbeliebte Ostmark und wird zum wichtigen – aber illegalen – Tauschmittel. Ingeborgs Vater schickt der Familie regelmäßig Geld auf ein Konto in Berlin, von dem die Mutter abhebt, um zu tauschen bzw. damit einzukaufen. Das ist verboten, und als sie eine Vorladung wegen Devisenvergehens erhält, ist klar, dass sie verhaftet werden soll. „Das war ein richtig schweres Vergehen,“ erläutert Ingeborg. „Sie wäre ins Zuchthaus und ich ins Heim gekommen“. Ihre Mutter will das auf jeden Fall verhindern.
Flucht in den Westen
So kommt es, dass Ingeborg 1955 mit ihrer Mutter in eine S-Bahn nach Berlin steigt im festen Glauben, es wäre ein normaler Besuch bei ihrer Tante in Neukölln. Doch als sie sicher im Westteil angekommen sind, eröffnet ihr ihre Mutter, dass sie nicht wieder zurückfahren werden. „Ich habe ein Riesentheater gemacht, ich hatte ja mein ganzes Leben in Werder verbracht, hatte meine Freundinnen dort und sollte nun alles nie wiedersehen.“ Ingeborg wehrt sich mit Händen und Füßen und wird schließlich von der Mutter und der Tante eingesperrt. „Ich musste schwören, nicht abzuhauen, erst dann haben sie mich wieder rausgelassen.“
Es ist tatsächlich anfangs nicht einfach für die Vierzehnjährige. Der Vater, den sie acht Jahre lang nicht gesehen hat, soll nun plötzlich zusammen mit ihnen in einem kleinen Zimmer in Rudow leben. Doch die anfängliche Befangenheit verfliegt schnell. „Mein Vater und ick verstanden uns auf Anhieb.“ Doch Ingeborg kann sich an die Großstadt nur schlecht gewöhnen. Ihr fehlen die Natur, der Sport, ihre Freunde. „Ich habe mich in Neukölln anfangs gar nicht über die Straße getraut bei dem Verkehr.“
Hinzu kommt, dass Ingeborg, die immer eine gute Schülerin war, im Westen kein Abitur machen kann. Ihr fehlen die Fremdsprachen, denn sie hat nur Russisch gelernt. Also beginnt sie eine Lehre als Industriekauffrau und verdient ihr erstes eigenes Geld – 75 Mark im ersten Lehrjahr. Die Arbeit macht ihr Spaß und nach drei Jahren darf sie bereits in der Finanzbuchhaltung arbeiten. „Ich war erst 18 und kriegte schon 320 Mark. Da war ich ganz stolz.“
Hochzeit, Kinder und Scheidungen
Über ihre Eltern lernt Ingeborg ihren ersten Mann Kurt kennen. Sie selbst findet ihn eigentlich uninteressant, aber die Neugier siegt. „Ich hatte ja keinen Freund und die Mädchen erzählten immer so viel,“ erinnert sich Ingeborg Krölke lachend. „Da ist es dann passiert und meine Tochter Martina war auch gleich unterwegs. Wir haben dann 1961 geheiratet.“ Sie heiratet nur, weil die Konventionen dies verlangen. „Ich wollte, dass mein Kind ehelich geboren wird, aber den Mann wollte ich nicht. Deshalb habe ich mich gleich wieder scheiden lassen.“ Ihre Eltern unterstützen sie mit ihrem Kind. Vor allem ihr Vater kümmert sich liebevoll um die kleine Martina, so als wolle er nachholen, was er bei seiner eigenen Tochter versäumt hatte.
Es ist auch ihr Vater, der Ingeborg zwei Jahre später mit dem Mann zusammenbringt, dessen Namen sie trägt: „Krölke“. „Er sah aus wie mein Vater – sehr gut aussehend.“ Er macht ihr an der Straßenbahnhaltestelle einen Heiratsantrag und will nicht eher einsteigen, bis er ihre Antwort hat. Doch Ingeborg lässt sich Zeit. Eigentlich wollte sie ja nicht mehr heiraten. Es ist seine Hartnäckigkeit, die dann doch ihren Widerstand bricht: „Ja gut, damit du endlich deine Bahn kriegst“, sagt sie schließlich. Sie heiratet 1964 zum zweiten Mal und bekommt 1967 eine zweite Tochter: Viola. 12 Jahre später lässt sie sich jedoch erneut scheiden. Der Mann ist als Fernmeldetechniker oft im Ausland und lässt sie mit den beiden Kindern allein. Als sie dann auch noch herausfindet, dass er mit ihren besten Freundinnen anbandeln wollte, zieht sie einen Schlussstrich. „Ich habe ihn zur Rede gestellt und ihm gesagt, bei mir ist bei sowat Feierabend.“
So konsequent sie ist, wenn sie merkt, dass eine Beziehung für sie nicht mehr funktioniert, so sehr glaubt sie aber immer noch, dass sie eines Tages den Richtigen finden wird. Und tatsächlich verliebt sie sich erneut. „Ich habe wirklich sehr, sehr schöne Jahre mit Norbert verbracht“, erinnert sich Ingeborg Krölke seufzend. Endlich hat sie ihre große Liebe gefunden, wie sie damals meint. Für Norbert wird sie zur Hausfrau, hat endlich genug Zeit für ihre Kinder und verwöhnt ihren Lebensgefährten so gut sie kann. „Der wusste ja nicht mal, wo ein Wasserglas steht. Ich habe ihm die Türen aufgemacht, wieder zugemacht und ihm seine Sachen hingelegt.“
Enttäuschung und Aufbruch
Lange scheint alles perfekt. Dann kommt ihr Partner plötzlich von einer Geburtstagsfeier nicht mehr nachhause. Vor Sorge wird Ingeborg fast verrückt. Irgendwann ruft er an, verlangt nach frischer Wäsche, die sie ihm ins Geschäft schicken soll, kommt aber nicht nachhause. Erst am dritten Tag erfährt Ingeborg von einem Freund, dass ihr Lebensgefährte mit einer anderen Frau zusammen ist. Ingeborg Krölke hält kurz inne beim Erzählen und sagt dann kichernd: „Manchmal denke ich heute, dass er sich nicht nachhause getraut hat, weil ich wohl mal im Freundeskreis gesagt habe, ich würde ihm bei Betrug im Schlaf sein Ding scheibchenweise abschneiden.“ Da ist es wieder, das junge Mädchen mit dem Schalk in den Augen.
1987 steht Ingeborg Krölke somit plötzlich auf der Straße. Der Mann ist weg, sie hat weder Wohnung noch Arbeit und sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. In ihren alten Beruf der Finanzbuchhaltung kann sie nicht zurück, da dort mittlerweile Computer eingesetzt werden. Das hat sie damals nicht gelernt. Doch sie hat ein gutes Netzwerk von Freunden und Nachbarn. Als erste hilft ihr ihre Kosmetikerin, die ihr einen kleinen Aushilfsjob in ihrem Geschäft anbietet. Schon bald merkt Ingeborg, dass ihr dieser Beruf großen Spaß macht und sie Talent hat. Sie möchte unbedingt mehr darüber lernen. Also fährt eine Nachbarin mit ihr alle Ausbildungsschulen ab, bis sie sich für eine entschieden hat und mit 46 Jahren eine Ausbildung als Kosmetikerin und Fußpflegerin beginnt.
In dieser Zeit leidet Ingeborg immer noch sehr unter der großen Enttäuschung, die sie in ihrer Beziehung erlebt hat. Zwölf Jahre lang hatte sie keine Sorgen, war verliebt, reiste viel und ging in der Rolle der Hausfrau vollkommen auf. Jetzt fühlt sie sich wie betäubt. Doch sie sucht nach Möglichkeiten, um besser damit umzugehen und ist offen für Neues. Bei der Heilpraktikerin Yashi Kunz belegt sie Kurse zur Selbstheilung, Homöopathie, Fußreflexzonentherapie, zum autogenen Training und vor allem zur Meditation. Sie lernt, wie man gedanklich durch den ganzen Körper geht und dabei Zelle für Zelle anspricht. Die Beschäftigung mit sich und die Kontaktaufnahme mit ihrem Körper tun ihr gut, und sie meditiert auch heute noch jeden Tag mehrmals.

Vorher
1989 schließt sie ihre Ausbildung erfolgreich ab und kann im Mai 1989 bereits ihr eigenes Kosmetikgeschäft in der Lübecker Straße in Berlin-Moabit eröffnen. Es ist ein großes Projekt, das sie fast allein, bzw. mit der Unterstützung guter Freunde und natürlich mit Handwerkern stemmt. Das Ladengeschäft muss vollständig saniert und umgebaut werden. In einem Fotoalbum hat sie die Anfangszeit dokumentiert. Die grellen Tapeten aus den 70er Jahren hängen in Streifen von der Wand, dahinter das rohe Mauerwerk und überall Staub und Dreck. Die gesamte Ausstattung ist aus
den 60er Jahren und muss komplett ersetzt werden. Nach und nach entsteht aus den dunklen Räumen mit niedrigen Decken, ein einladendes helles Geschäft mit Spiegelschränken, Kronleuchter und Erinnerungsstücken von Reisen.
Vertrauen
Ingeborg Krölke ist voller Energie, doch die Selbständigkeit ist auch schwer. „Ich hatte ja praktisch kaum Geld und es war Glück, dass meine Lebensversicherung gerade fällig wurde. Die habe ich dann komplett ins Geschäft gesteckt.“ Sie ist fest davon überzeugt, dass die Dinge immer gut ausgehen werden – egal wie schwierig sie gerade scheinen. „Ich fühle mich immer beschützt und glaube fest an den Spruch meiner alten Tante: Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“ Diesen Spruch hat sich Ingeborg an die Wand gehängt. „Es gab schon so oft Situationen, wo ich dachte, oh Gott, Monatsende, Miete, Krankenkasse, Versicherung. Dir fehlt noch soundsoviel. Und dann habe ich gedacht, bleib ganz ruhig, es sind noch zwei Tage.“
In einem ihrer Behandlungsräume steht ein großer hölzerner Buddha. Immer, wenn Ingeborg Krölke mit einem Problem zu kämpfen hat, geht sie zu ihm und umgreift seine nach oben gereckten Holzhände. Sie empfindet dann tiefe Ruhe und Kraft und ist ganz bei sich. Sie ist überzeugt, dass neben guten Freunden auch er seinen Anteil daran hat, dass sie immer wieder wie durch ein Wunder aus finanziellen Engpässen gerettet wurde. „Immer, wenn ich mit ihm gesprochen hatte, kam plötzlich eine Kundin und wollte eine Sauerstoffbehandlung oder einen Wickel oder ein 10er-Abo – das sind meine teuersten Angebote. Da war ich dann jedesmal gerettet. Ick mach mir da heute gar keinen Kopp mehr.“
“Meinen Schnupfen habe ich am Wochenende.”
Allerdings verlässt sie sich nicht in allem auf Buddha, sondern weiß auch, dass vieles durch sie selbst entstanden ist. „Ich habe vor allem von meinem Vater viel gelernt. Er legte immer sehr viel Wert auf Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Fleiß. Er hat immer gesagt ‚des Soldaten Pünktlichkeit ist fünf Minuten vor der Zeit‘.“ Es sind wohl vor allem der Fleiß und das Durchhaltevermögen, die Ingeborg Krölke prägen. „Ich muss schon die Treppe runterfallen und mich nicht mehr bewegen können, dass ich im Bett bleibe. Aber ansonsten bin ich immer hier. Meinen Schnupfen habe ich am Wochenende.“ Warum sollte sie auch zuhause bleiben, wenn sie in ihrer Arbeit keine Belastung, sondern eine Bereicherung sieht? Sie möchte auf jeden Fall solange arbeiten wie möglich, wenn es geht, sogar noch zehn Jahre. Dann ist sie 87.„Ich bedaure all die Menschen, die wirklich denken, ach schon wieder Montag. Ich kann mir keinen schöneren Beruf als meinen vorstellen und komme immer gern in mein Geschäft.“
Ingeborg betreut viele ihrer Kunden schon jahrelang. Mit viel Einfühlungsvermögen berät sie junge Menschen zu ihren Akneproblemen oder verordnet manch älterem Herrn, er möge zu seinen Füßen „nett sein“ und sie ordentlich pflegen. „Da ist mein Alter ein Vorteil, denn ich kann auch mal schimpfen,“ sagt Ingeborg lachend. Zu ihren Kunden hat sie oft eine ganz besondere Beziehung, da viele ihr sehr private Dinge erzählen. Sie hilft bei allen Problemen so gut sie kann. Oft reicht schon ein gutes Gespräch oder jemanden in den Arm zu nehmen. „Einige kommen mit hängendem Kopf und wenn sie gehen, sind sie ein bißchen aufgemuntert. „Das macht mich glücklich!“
Die wahre Liebe
Ingeborg Krölke liebt die Menschen, das merkt jeder, der mit ihr zu tun hat. Kundinnen, die aufgrund ihres Alters nicht mehr kommen können, betreut sie zuhause oder in ihrem Pflegeheim weiter. Für andere, die direkt von der Arbeit zu ihr hetzen, kauft sie extra Brot ein, damit sie erst einmal etwas zu essen bekommen. Vor einiger Zeit hat sie eine Sammelaktion gestartet. In ihrem Geschäft steht ein Regal mit Büchern, die sie von ihren Kunden geschenkt bekommt. Gegen eine kleine Spende kann sich jeder etwas aussuchen. Mit diesem Geld unterstützt sie zwei Kitas in der Nachbarschaft, die davon Bastelsachen oder Spiele kaufen können.
Mit fast allem ist Ingeborg Krölke im Reinen – ihrem Beruf, ihrem Leben, ihren Kindern. Aber mit einem kann sie sich nicht abfinden: ihrem schlechten Gehör. In den stressigen Anfängen ihrer Selbständigkeit wurde ein Hörsturz nicht erkannt und somit nicht behandelt. Seitdem hört sie jedes Jahr schlechter. „Da klappt irgendwie die Zusammenarbeit mit Buddha nicht“, sagt Ingeborg lachend. „Ich weiß einfach nicht, was mir das Universum da beibringen möchte. Vielleicht Abschalten.“ Für sie ist das ein großer Kummer. Sie kann weder richtig Radio hören, noch ins Kino oder Theater gehen. Neuen Kunden sagt sie daher anfangs Bescheid, damit sie möglichst deutlich mit ihr sprechen. Und wenn sie einen Anrufer nicht versteht, reicht sie schon mal den Hörer an eine Kundin weiter, damit die für sie die Informationen aufnimmt. „Irgendwie komme ich schon klar. Ich weiß ja, ich kann da nichts dran ändern.“
Manchmal denkt sie noch daran zurück, wie hilflos sie sich fühlte, als ihre große Liebe sie verließ. „Heute denke ich, ich würde mich sehr gern bei ihm bedanken. Hätte er mich damals nicht verlassen, wäre ich nicht die, die ich heute bin.“ Durch ihn hat sie ihre wahre Liebe erst gefunden. Und die hält nun schon fast 30 Jahre: Ein selbstbestimmtes Leben in ihrem Traumberuf.

Ingeborg Krölke trifft man hier:
Fußpflege u. Kosmetisches Institut Ingeborg Krölke
Lübecker Str. 44
10559 Berlin
Tel / Fax: 030 3941244
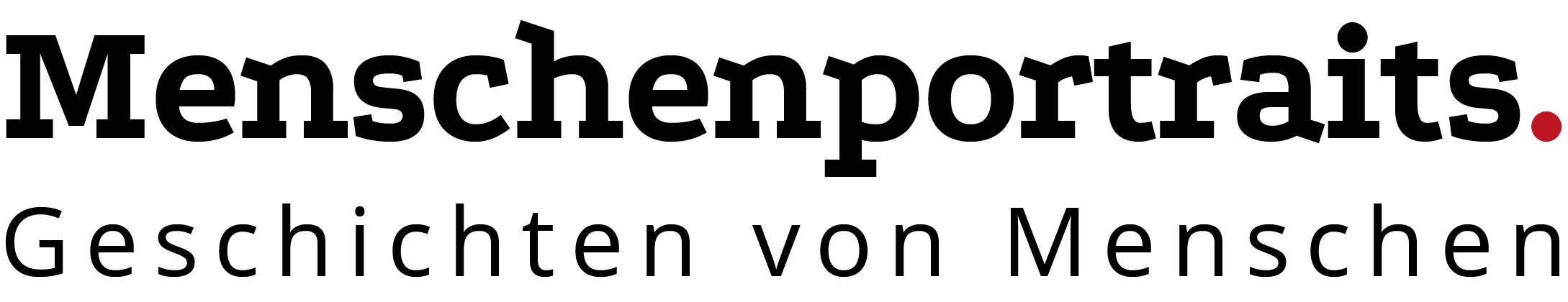









 Sein Atelier, in dem er in gefährlich schwankenden Stapeln seine Kunst aufbewahrt hatte, ist nur noch ein Trümmerhaufen. Über tausend Bilder hat er nicht unterstellen können, als er aufgrund der Räumungsfrist ausziehen musste. Sie wurden nun zerstört. Für jemanden, der kein einziges seiner Kunstwerke je weggeworfen hat, ist dies eine harte Probe. Da Petrus gerade eine dreijährige Ausbildung zum Altenpfleger begonnen hat, blieb ihm einfach keine Zeit, alles auszuräumen. „Ich stehe morgens um halb fünf auf, fahre zur Arbeit, arbeite acht Stunden oder mache Doppelschichten und habe auch noch ein Pferd, um das ich mich kümmern muss.“ Doch Petrus findet trotz allem, dass er es besser als andere hat: „Meine Kindheit war so Scheiße, dass mir die jetzige Situation leicht fällt, weil ich ja trainiert bin.“
Sein Atelier, in dem er in gefährlich schwankenden Stapeln seine Kunst aufbewahrt hatte, ist nur noch ein Trümmerhaufen. Über tausend Bilder hat er nicht unterstellen können, als er aufgrund der Räumungsfrist ausziehen musste. Sie wurden nun zerstört. Für jemanden, der kein einziges seiner Kunstwerke je weggeworfen hat, ist dies eine harte Probe. Da Petrus gerade eine dreijährige Ausbildung zum Altenpfleger begonnen hat, blieb ihm einfach keine Zeit, alles auszuräumen. „Ich stehe morgens um halb fünf auf, fahre zur Arbeit, arbeite acht Stunden oder mache Doppelschichten und habe auch noch ein Pferd, um das ich mich kümmern muss.“ Doch Petrus findet trotz allem, dass er es besser als andere hat: „Meine Kindheit war so Scheiße, dass mir die jetzige Situation leicht fällt, weil ich ja trainiert bin.“ Akkordeon fällt bereits in seiner Schulzeit mit ungewöhnlichen Aktionen auf. Ihn fasziniert, wie man Sichtweisen und dadurch die Realität verändert. Als 1990 sein Vater stirbt, will Akkordeon den Tod besser verstehen. Er bringt an einem Freitag einen großen Rinderknochen in die Schule und legt ihn in eine Glasvitrine der Kunst-AG in die Sonne. Die Vitrine schließt er ab. Am Montag zieht Verwesungsgeruch durch die Schule und die Lehrer sind empört. Akkordeon weigert sich eine Woche lang, die Vitrine wieder aufzuschließen. Er will unbedingt etwas sichtbar machen, was man sonst nicht sehen würde und nimmt dafür jeden Ärger in Kauf.
Akkordeon fällt bereits in seiner Schulzeit mit ungewöhnlichen Aktionen auf. Ihn fasziniert, wie man Sichtweisen und dadurch die Realität verändert. Als 1990 sein Vater stirbt, will Akkordeon den Tod besser verstehen. Er bringt an einem Freitag einen großen Rinderknochen in die Schule und legt ihn in eine Glasvitrine der Kunst-AG in die Sonne. Die Vitrine schließt er ab. Am Montag zieht Verwesungsgeruch durch die Schule und die Lehrer sind empört. Akkordeon weigert sich eine Woche lang, die Vitrine wieder aufzuschließen. Er will unbedingt etwas sichtbar machen, was man sonst nicht sehen würde und nimmt dafür jeden Ärger in Kauf.
















Kommentare