Renate Faltin
Wäre Renate Faltin auch Opernsängerin geworden, wenn sie nicht in einem DDR-Kinderheim aufgewachsen wäre? Eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist, aber doch liegt es nahe. Nach der Geburt von Renate in Parchim, ergriff ihre politisch überzeugte Mutter Anni in den Nachkriegsjahren die Chance, sich im Schnellverfahren als Volksrichterin fortzubilden. Da sie selbst im Internat leben musste, konnte sie ihre unehelich geborene Tochter nicht mit unterbringen – also kam Renate ins Kinderheim, erst in Neuruppin, dann in Potsdam. Eine Zeit voller Einsamkeit, die prägend war. Schon früh musste sie die Entscheidung treffen: untergehen oder aushalten. Sie entschied sich für das „Aushalten“, denn sie musste erst wissen, wer sie ist, um sagen zu können: „Nein, das will ich nicht.“
Es gab vieles in ihrer Kindheit, was ihr das Herz überlaufen ließ. Da ist zum Beispiel dieser Tag, an dem sie ihre Mutter vermisst. Sie ist neun Jahre alt und läuft kilometerweit vom Kinderheim zur Mutter ins Potsdamer Zentrum und klingelt. Doch die Mutter weist sie ab. „Sie kam raus, hat mich gesehen und hat gesagt, das ist nicht in Ordnung, du gehst jetzt wieder zurück‘. Dann hat sie die Tür zugemacht.“ Bis heute hat sich dieses Ereignis traumatisch in Renates Gedächtnis eingebrannt und Spuren hinterlassen. Auch das Leben im Kinderheim ist alles andere als glücklich. Renate zählt dort zu den Schwächeren und ist daher einer brutalen Rangordnung durch die älteren Jungen unterworfen. Wie eine Dienerin muss sie für sie die Schulmappen schleppen und Mutproben bestehen. „Ich musste zum Beispiel außen auf einer schmalen Brüstung im Hochparterre zum nächsten Fenster balancieren“. Auch seelische Grausamkeiten sind an der Tagesordnung für das kleine Mädchen, die schockiert zusehen muss, wie die Jungs den Fliegen die Flügel ausreißen und die Tiere langsam torkelnd verenden lassen. „Ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Mensch. Weil ich aber im Heim und bei meiner Mutter nicht verletzlich sein durfte, habe ich mir angewöhnt, nach außen hin abweisend zu wirken.“ Und doch gibt es in ihr dieses Bedürfnis, ihre Gefühle mit jemandem zu teilen. Es darf nur niemand sein, der sie kennt. Deshalb sprach sie damals, wenn sie es nicht mehr aushielt, einfach fremde Menschen an. „Ich habe mir Leute in der Straßenbahn gekrallt, um denen mein Herzeleid auszuschütten, weil ich wusste, dass ich die nie wieder sehen würde.“
Renate Faltin klingt nicht verbittert, wenn sie davon erzählt. Ja, es sei sicher traurig aus heutiger Sicht, aber sie habe es damals nicht so empfunden – sie kannte es ja nicht anders. Mit einem kleinen Lachen streicht sie sich durch ihr nach hinten gebundenes, schwarzgrau meliertes Haar und lehnt sich im schwarzen Ledersessel zurück. Ihre dunkelbraunen Augen sind auf die Wand vor ihr gerichtet, während sie sich erinnert. „Dieses Gefühl, mich anderen mitteilen zu wollen, Gefühle zu transportieren und Verbundenheit zu erzeugen, aber ohne erkannt zu werden, habe ich auch als Sängerin später gehabt.“ Während ihre Kollegen nach der Vorstellung Autogramme geben, schleicht sich Renate Faltin nach bejubelten Auftritten als Königin der Nacht lieber unerkannt aus dem Haus. Bühne ist Bühne und privat ist privat. Sie möchte selbst entscheiden, wann und wem sie sich zeigt.
Heute sieht Renate in ihrer schwierigen Kindheit tatsächlich einen Grund, warum sie es geschafft hat, Opernsängerin zu werden. Denn ihr Weg in den Beruf war alles andere als einfach. Dafür musste sie vieles aushalten und oft auch kämpfen – Stärken, die sie als Kind ausbilden musste, um zu überleben. Während der Heim- und Schulzeit konnte sie keine eigenen Ziele verfolgen. Sozialistische Erziehung, Regeln befolgen, lernen, was der Staat vorgibt. „Ich erinnere mich an die Lautsprecherdurchsage in den Fluren, als Stalin 1953 gestorben ist. Da sind unsere Erzieher heulend und schreiend über den Tischen zusammengebrochen.“ Dabei ist für Renate schon mit vierzehn klar, dass ihr Weg ein anderer sein soll. Als sie zum ersten Mal die Oper „La Bohème“ erlebt, weiß sie, dass sie auch auf die Bühne möchte. „Opernsängerin war von da an mein Traumberuf, aber ich habe dann immer behauptet, dass ich Tierarzt werden will,“ sagt Renate Faltin. So erspart sie sich Fragen und geht Diskussionen aus dem Weg. Sie hat schnell gelernt, dass das wohl nicht ins sozialistische Weltbild ihrer Umwelt passen würde.
Renate quält sich durch das für sie vorgegebene naturwissenschaftliche Abitur, obwohl ihre Stärken kreative sind. „Ich konnte super Gedichte aufsagen, schön singen und habe sehr gern Theater gespielt.“ Wenn sie etwas vortragen kann, ist sie glücklich, denn die Momente, in denen sie von anderen bewundert und beachtet wird, sind selten. „Ich hatte ja keine Freunde,“ sagt Renate und lacht kurz auf. Einer der Gründe ist der Beruf ihrer Mutter, die mittlerweile als Richterin arbeitet. „Wir mussten uns von der Schule her einmal eine Gerichtsverhandlung ansehen. Und dann war ausgerechnet ich mit meiner Klasse dabei, als meine eigene Mutter irgend so ein armes Schwein verurteilte, das einen Witz über Walter Ulbricht gemacht hatte.“
Mit zehn Jahren kann Renate das Kinderheim verlassen und zu ihrer Mutter ziehen. Diese arbeitet in der Bezirksleitung der SED als Instrukteur für Justiz in Potsdam und hat nun endlich eine eigene Wohnung bekommen. Die Konflikte zwischen Mutter und Tochter spitzen sich zu, denn sie sehen sich nun jeden Tag. „Man sagt ja, die Bindung zu einer Mutter entsteht in den ersten Jahren – aber die hatten wir ja nicht.“
Auf der Suche nach dem unbekannten Vater
Eines der größten Konfliktthemen ist der unbekannte Vater. Ihre ganze Kindheit über wollte Renate wissen, wer er ist und wie ihn die Mutter kennengelernt hat. Doch diese lehnt es kategorisch ab, darüber zu sprechen. Stattdessen wird sie jedes Mal wütend und behauptet lange, der Vater sei im Krieg gefallen, was Renate aber nie glaubt, da sie erst 1946 geboren wurde. In den Augen der Mutter war der Vater „ein schlechter Mensch“, und damit musste sich die Tochter zufrieden geben. Kein Name, keinerlei Informationen.
Bis Renate in der Schule lernen soll, wie man einen Lebenslauf schreibt. Sie zeigt der Mutter die Aufgabe und fragt, was sie bei „Vater“ eintragen soll. Die Mutter bekommt wieder einmal einen Wutanfall. Diesmal vielleicht, weil sie im Zwiespalt ist. Wenn sie sich weigert, etwas zu sagen, wird der Lebenslauf ihrer Tochter in der Schule eine Lücke aufweisen, doch wenn sie erzählt, dass Renates Vater lange wegen Schmuggels nach dem Krieg gesucht wurde und mittlerweile im Westen lebt, könnte sie ihre Tochter verlieren. Sie ahnt wahrscheinlich, wie sehr sich Renate wünscht, ihren Vater zu treffen. 1959 gibt es noch keine Grenze, die dies verhindert hätte. Die Mutter tobt und schreit, aber nennt dann tatsächlich den Namen und das Geburtsdatum des Vaters. In ihrer Wut gibt sie auch preis, dass er in Schönwalde bei Berlin geboren wurde, verheiratet ist und einen weiteren Sohn hat. Jedes ihrer Worte brennt sich in Renates Gedächtnis ein. „Ich hatte das starke Bedürfnis, endlich meine Wurzeln zu kennen.“ Auf einem kleinen grünen Zettel notiert sie sich jedes Detail, das sie eben erfahren hat und steckt ihn in ihr Portemonnaie. So hat sie ihren Vater Erwin und ihren Halbbruder Harry immer bei sich, auch wenn sie nicht weiß, wo sie sind.
„Gerade wenn man sich so alleine fühlt und keiner hilft einem, dann hätte man gerne entweder einen großen starken Bruder oder einen Vater, der mal so richtig Bescheid sagt.“ Doch Renate hat gelernt, alles zu vermeiden, was ihre Mutter aufregen oder missfallen könnte, denn sie fürchtet ihre heftigen Reaktionen. „Meine Mutter hat mir immer gedroht, wenn irgendwas war, dass ich sie um den Verstand bringe oder dass sie sich das Leben nehmen würde. Immer wieder.“ Erst nach der Wende, als der Vater bereits gestorben ist, lernt sie durch Nachforschungen ihren Halbbruder Harry kennen. Dass Renate seine Halbschwester ist, wird Harry klar, als sie ihm in einem Brief den Diamantring beschreibt, den ihre Mutter von Harrys Vater damals erhalten hat. „Mein Vater hat doch die Dämlichkeit besessen, sowohl seiner Frau als auch seiner Geliebten den gleichen Ring zu schenken.“ Renate schüttelt den Kopf, aber muss dabei lachen. Denn seine Dummheit hat ihr geholfen, ihren Halbbruder zu finden. Und das war für sie eines der größten Geschenke, das ihr das Leben machen konnte.
Trotz einer fachlich nicht guten Hauptfachlehrerin und wenig Unterstützung schafft Renate ihr Studium – sie beißt sich durch, erträgt vieles, weil sie ihr Ziel unbedingt erreichen möchte. „Damals war es noch so, dass man nach vier Jahren einen Chorsänger- oder nach fünf Jahren einen solistischen Abschluss machen konnte. Für den Soloabschluss kam ich als ‚Miss Mäusehusten‘ eigentlich nicht in Frage,“ stellt Renate nüchtern fest. Und doch ist es genau das, was sie möchte. Also bewirbt sie sich noch während ihres Studiums an einem sehr kleinen Theater, dem Theater Senftenberg, „eine Klitsche“, wie sie sagt. Dort will man sie nehmen, wenn sie noch ein Jahr studiert und ihren solistischen Abschluss macht. „Ich bin dann an meine Schule und habe gesagt – so. Wenn ihr mich noch ein Jahr hier lasst, dann nehmen die mich. Und dann habe ich tatsächlich nochmal ein Jahr gekriegt.“
Heirat, Kind und Karriere
Während des Studiums lernt Renate an der Hochschule ihren späteren Mann Peter kennen, der dort unterrichtet. „Im letzten Jahr haben wir dann bemerkt, dass es doch für länger sein könnte.“ Sehr zurückhaltend erzählt sie von dieser Liebe, die nur sie selbst etwas angeht. Sie wollen heiraten, doch Renate möchte ihren eigenen Namen behalten – ihr Name ist durch verschiedene Auftritte in der Theaterwelt bereits bekannt. Da sie keinen Doppelnamen möchte und es damals in der DDR unmöglich ist, jeweils den eigenen Namen zu behalten, heiraten sie schließlich in Ungarn. „Das hatte ganz böse Folgen,“ sagt Renate. „Jedesmal, wenn wir im Hotel unsere Ausweise vorlegten, hat die Rezeptionistin einen roten Kopf gekriegt und ihre Vorgesetzte geholt.“ Renate imitiert amüsiert den damaligen Dialog: „Herr Kroll, Sie sind verheiratet? Jaaa! Und Frau Faltin, sind Sie verheiratet? Jaaaaa! Aber nicht mit dem Mann? Dooch!“ Für zukünftige Reisen besorgen sie sich schließlich eine staatlich beglaubigte und übersetzte Eheurkunde, um im selben Zimmer übernachten zu können.
1970, als Renate 24 Jahre alt ist, wird ihr Sohn Sebastian geboren. Zwei schlecht bezahlte und anstrengende Jahre am Theater Senftenberg und eine Zeit der freiberuflichen Tätigkeit liegen hinter ihr. Sie beginnt am Operettentheater in Dresden zu arbeiten und sie und ihr Mann pendeln abwechselnd mit dem Sohn zwischen den Städten hin und her. „Mit dem Trabant auf den schlechten Straßen hat das schon ein bisschen gedauert.“
Glanzrolle: Die Königin der Nacht
Ihre erste Rolle war das Hannchen in der Operette „Der Vetter aus Dingsda“. „Diese Rolle hat mich dann ewig verfolgt,“ sagt Renate Faltin und kichert, während sie in ihrem Ordner blättert, in dem sie alle Stationen ihrer Karriere abgeheftet hat. Als sie 1981 ihre Tochter Susanna bekommt, ist sie bereits gefragte Koloratur-Sopranistin für die schwierige Rolle der Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte. 1977 trat sie zum ersten Mal im Theater Rostock in dieser Rolle auf und wird seitdem immer wieder von verschiedenen Opernhäusern der DDR engagiert. Herausfordernd sind die beiden Arien, bei denen die Stimme besonders in den hohen Tonlagen sehr beweglich sein muss. „Wenn da eine Note falsch ist, hört das jeder Dussel,“ sagt Renate Faltin und fügt hinzu: „Und weil ich sehr, sehr sicher in dieser Höhe war, wurde ich häufig von heute auf morgen als Ersatz angefragt.“
Auf einem Foto im Ordner sieht man Renate in der Rolle der Königin der Nacht. Riesige, dunkle Augen unter einer eng anliegenden Kappe blicken direkt in die Kamera. Ein langer schlanker Hals schwebt über dem dunklen Kostüm mit dem bestickten Stehkragen. Der Blick hält den Betrachter gefangen, er strahlt Trauer und doch gleichzeitig Entschlossenheit und Kraft aus. Es ist nicht die Königin, die man auf dem Bild sieht. Es ist Renate Faltin selbst, die sich sich hier – unter dem Schutz der Rolle – hervorwagt, sich zeigt.
Renate Faltin beginnt 1971 neben ihrem Engagement am Theater Senftenberg an ihrem spielfreien Tag zunächst Kinder und Jugendliche an einer Musikschule in Berlin-Treptow zu unterrichten. Ihr Unterricht ist beliebt und ihr macht es großen Spaß, ihr Wissen weiterzugeben. 1977 folgt eine zweijährige pädagogische Aspirantur an der Hanns Eisler Hochschule, bei der sie nun Studenten unterrichtet, aber parallel von einer Mentorin unterstützt wird. „Das war die beste Lehrerin an der Hochschule“, sagt Renate Faltin heute. 1979 setzt sie ihre pädagogische Karriere als „Oberassistent für Gesang“ an der Hochschule fort und arbeitet nun mit eigenen Hauptfachklassen für Chor- und Sologesang. „Ich hatte immer schwierige Fälle, um die ich mich kümmern musste. Das hat mich gefordert, denn ich musste überlegen, wie ich ihnen helfen konnte.“
Den Auftritt überleben
Renate sieht und hört genau hin, wenn ihre Studenten singen. Oft haben sie sich über die Jahre falsche „Einstellungen“ angewöhnt, die sie nun gemeinsam mit ihnen korrigiert. „Die erste Regel für den Sänger ist es den gesamten Auftritt zu überleben. Es könnte ja noch eine Arie kommen,“ sagt Renate Faltin und lacht. Sie weiß genau, wie Gaumensegel, Lippen und Zunge bewegt werden müssen, um die Töne richtig und dabei ohne Kraftaufwand zu erzeugen. Das ist wichtig, damit die Sänger auch lange Musikstücke problemlos bewältigen können. „Was mir damals sehr geholfen hat, war meine Arbeit für die ‚Berliner Gesangswissenschaftlichen Tagungen’ der Charité“, fährt sie fort. „Ich war der Vertreter für die Hochschule und leitete gemeinsam mit Prof. Dr. Seidner von der Charité die Veranstaltungen.“ Auf der Tagung trafen sich Fachärzte (Phoniater), Gesangspädagogen und Sänger aus dem ganzen Land und tauschten sich über Klangerzeugung und die aktuellsten Erkenntnisse zur Funktionsweise der Stimme aus. Renate profitiert von diesen fachübergreifenden Erfahrungen und hält auch selbst Vorträge, leitet Veranstaltungen und stellt Methoden aus ihrem Unterricht vor. Nur mit der Unterstützung ihres Mannes schafft sie es, ihre Familie, die Gesangskarriere und den Unterricht unter einen Hut zu bekommen. „Meine Mutter konnte ich dabei ja vergessen,“ fügt Renate hinzu. Sie blickt geradeaus, keine Mimik verrät, welches Gefühl sie damit verbindet.
Besonders ihre Tochter Susanna braucht viel Aufmerksamkeit, denn sie ist Asperger-Autistin, was jedoch damals nicht erkannt wird. In der Schule ist sie oft blockiert vor Angst, will nicht sprechen, doch die Lehrer deuten dies als Verweigerungshaltung, was zu Problemen führt. Den Schulstoff muss Renate zuhause mit ihr mit ganz individuellen Methoden erarbeiten, da sie in der Schule nicht folgen kann. Wie bei ihren Schülern und Studenten auch, versetzt sie sich jetzt in die Lage ihrer Tochter und gibt nicht auf, bis sie die richtige Methode gefunden hat. „Ich musste mir immer etwas ausdenken, damit sie verstand, was gemeint war. Zum Beispiel Multiplikation anhand von Tassen und Murmeln.“
Karriere an der Hochschule
Während sich Renate in den achtziger Jahren zur gefragten Opernsängerin und Gesangspädagogin entwickelt, findet in der DDR ein dramatischer künstlerischer Aderlass statt. Seit der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 1976 haben über 350 Schauspieler, Regisseure, Schriftsteller und bildende Künstler in den 1980er Jahren die DDR verlassen. Wer Kritik übt, erhält Auftrittsverbot oder wird politisch verfolgt.
„Für meine Mutter hatte die Partei immer Recht, denn der Sieg des Sozialismus stand über allem. Mir lag das aber nicht.“ Renate ist nicht in der Partei – sehr zum Bedauern ihrer Mutter. „Zunächst bin ich nicht in die Partei gegangen, weil ich mich nicht gut genug fühlte, selbstredend. Ich war ja nur ein blöder Student. Dann irgendwann stellte ich fest, hier stimmt was nicht und dann hätten mich auch keine zehn Pferde mehr reinbekommen.“ Diese Weigerung ist immer wieder Anlass für Streite mit der Mutter, die sogar Renates Mann dafür Vorwürfe macht, dass er es nicht schafft, sie umzustimmen.
Nach sieben Jahren als Oberassistent wird Renate Faltin 1986 vom damaligen Rektor Prof. Olaf Koch der Hanns Eisler Hochschule für eine Dozentur vorgeschlagen – eine deutliche Verbesserung gegenüber ihrer aktuellen Position: „Als Dozent musstest du weniger arbeiten als die Oberassistenten und hattest endlich auch eine Altersversicherung.“ In der DDR war es nicht möglich, sich für eine derartige Position zu bewerben. Stattdessen hing alles davon ab, dass ein Vorgesetzter die Berufung als Dozent am eigenen Institut vorschlug. Die formale Ernennung erfolgte dann in einem öffentlichen Festakt über das Ministerium für Kultur.
Doch Renate glaubt immer noch, dass sie auf Basis der DDR-Verfassung erfolgreich klagen kann und wendet sich an einen Juristen. „Der hat mir dann ganz deutlich gesagt, ich könne zwar klagen, aber dass ich am Schluss kein Recht kriegen würde.“ Erst da wird ihr klar, dass es naiv und blauäuig war, den Staat herauszufordern. Hinzu kommt, dass ihr der Rektor in einem Kadergespräch nahelegt, ihren Antrag an die Konfliktkommission zurückzuziehen, da es sonst „keine Klarheit über ihre weitere Tätigkeit und Entwicklung gäbe“, wie es im Gesprächsprotokoll heißt. Diese nur schwach verschleierte Nötigung bringt ihre sozialistische Überzeugung vollkommen ins Wanken.
Renate Faltin wird schließlich weder zur Dozentin berufen, noch wird ihrem Antrag für eine gerechte Bezahlung für sich und weitere betroffene Mitarbeiter stattgegeben. Ihre Arbeitssituation an der Hanns Eisler Hochschule wird immer schwieriger, Kollegen beginnen, sie zu schneiden und setzen sich in Versammlungen nicht mehr zu ihr.
Doch die Studenten schätzen sie sehr. Immer wieder wechseln sie bewusst zu ihr, weil sie unzufrieden mit anderen Lehrern sind. Es spricht sich herum, dass man bei ihr mit Problemen nicht allein gelassen wird. Wenn Fragen entstehen, forscht Renate so lange, bis sie ihren Studenten eine fundierte Antwort geben kann. Manchmal stellt sie sich so lange vor einen Spiegel und probiert Zungen-, Gaumen-, Mundstellungen aus, bis sie herausgefunden hat, was ihr Student falsch macht.
DDR im Umbruch
Renate Faltin ist keine Systemkritikerin. Doch sie kann nicht alles einfach hinnehmen – trotz der sozialistischen Erziehung in den SED-Kinderheimen und ihrer linientreuen Mutter. Ihre Erfahrung mit der Berufung lässt sie immer weiter zweifeln. Im Oktober 1988 beschließt die DDR-Regierung, das sowjetische Magazin „Sputnik“ nicht auszuliefern. Es hatte über den von der SED verleugneten deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt berichtet. Renate Faltin ist als Abonnentin verärgert über diese Gängelung. Sie nimmt ein altes Titelblatt des Magazins, gestaltet es als Traueranzeige um mit schwarzem Rand, Kreuz und dem „Todesdatum“ Oktober 1988 und hängt es an die Wand der Hochschulmensa. „Zum Glück bin ich nicht erwischt worden,“ sagt Renate nachdenklich.
Außerhalb der Hochschule herrscht Unruhe in der DDR. Die Glasnost-und Perestroika-Bewegung in der Sowjetunion lässt viele Bürger hoffen, dass auch das DDR-Regime sich offen für Veränderungen zeigt. Immer deutlicher fordern sie Reformen ein. Doch die DDR-Regierung sieht keinen Anlass für Selbstkritik und geht mit aller Macht gegen ihre Kritiker vor.
Im Januar 1989 gelingt es 500 Menschen, auf dem Leipziger Marktplatz für das Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie Pressefreiheit zu demonstrieren. Über 50 Demonstranten werden verhaftet, aber nach Solidaritätsaktionen in vielen DDR-Städten nach wenigen Tagen Haft wieder freigelassen. Es formieren sich die Leipziger Montagsdemonstrationen, bei denen im Herbst erstmals 1200 Menschen durch die Innenstadt ziehen. Renate Faltin erlebt dies hautnah, denn sie hat zu dieser Zeit ein Engagement am Leipziger Opernhaus für die Zauberflöte und pendelt für die Proben zwischen beiden Städten hin und her.
Der Anfang vom Ende der DDR
Die politische Unruhe ist auch auf die Musikhochschule übergesprungen, wo über die Zukunft der DDR diskutiert wird und die alten Abteilungsleiter von den Studenten und einigen Lehrern nicht mehr akzeptiert werden. Nachdem die Polizei am 7. Oktober, dem 40. Jahrestages der DDR, Demonstranten mit brutaler Gewalt niederknüppelt, verhaftet und misshandelt, ist Renate Faltin sehr betroffen. Sie folgt der Initiative von Berliner Schauspielern und Künstlern und nimmt am 28. Oktober 1989 – zehn Tage nach Honeckers Rücktritt, an der Lesung von Ulrich Mühe im Deutschen Theater teil. Mühe liest aus Walter Jankas Memoiren „Schwierigkeiten mit der Wahrheit“, die zu diesem Zeitpunkt nur im Westen erschienen sind. Janka rechnet in seinem Buch ab mit politischer Heuchelei, Polizeistaatlichkeit, Rechtsbeugung und Menschenverachtung. Die Schlange vor dem Theater reicht bis zur Friedrichstraße, die Lesung wird mit Lautsprechern auf die Straße übertragen, einige Menschen weinen.
Am 4. November findet auf dem Alexanderplatz die erste genehmigte nichtstaatliche Demonstration der DDR mit über 500.000 Teilnehmern und bekannten Rednern wie Stefan Heym, Gregor Gysi, Christa Wolf oder auch Heiner Müller statt. Auch Renate ist dabei: „Viele wünschten sich – wie ich – eine bessere DDR, ohne sie ganz abschaffen zu wollen. Aber dann habe ich einige schwarz-rot-goldenen Fahnen ohne DDR-Emblem gesehen und wusste plötzlich: die DDR wird es nicht mehr geben, die Menschen wollten einfach ein besseres Leben.“ Am 9. November fällt die Mauer und die DDR, wie sie einmal war, beginnt sich aufzulösen.
Trauer und Überleben
Doch im November 1989 stirbt Renates Mann an einem Herzinfarkt. Das lässt alles andere plötzlich unwichtig werden. Trotz des Schocks und der Trauer muss Renate irgendwie funktionieren: Susanna, ihre Bühnenauftritte, die Gesangsklasse und Behördengänge. Kurz vor Weihnachten muss sie aufs Amt gehen, um ihren Mann persönlich abzumelden und seinen Personalausweis abzugeben. Renate nimmt alles wie unter einem Schleier wahr, alles wirkt auf sie unwirklich. „Ich musste zuhören, wie die Frauen sich am Telefon über Weihnachtsgeschenke austauschten, und sollte gleich sagen ‚guten Tag, mein Mann ist gestorben.“ Die Art wie sie erzählt, lässt nur ahnen, wieviel Kraft es sie gekostet haben muss, diese Zeit zu überstehen. Sie verbirgt ihr Gefühl hinter einer Szenenbeschreibung, lässt nur den Zuschauerblick zu. Diese Distanz ist es, mit der sie andere Menschen täuscht und glauben lässt, sie sei nicht emotional und somit auch nicht verletzlich. Ihre Gefühle gibt sie Fremden nicht gern preis, das hat sie verinnerlicht, denn es hat ihr geholfen, ihre lieblose Kindheit zu überleben. Ihre Stärke schöpft sie auch aus dieser Zeit. Nur so hat sie ihre Tochter versorgt, ist aufgetreten, hat unterrichtet, ist mit dem Alleinsein klargekommen und hat sich ein neues Leben in einem für sie neuen Land aufgebaut.
1990, unter einer neuen Rektorin, erhält Renate Faltin endlich die ursprünglich versprochene Dozentenstelle – rückwirkend ab Februar und bis zum offiziellen Ende der DDR. Es ist eine Art Aufarbeitung durch die Hochschule für Musik, von der auch Studenten profitieren, die damals aus politischen Gründen ihr Examen nicht machen durften. Kurz darauf stellt Renate Strafanzeige gegen den damaligen Rektor Prof. Ragwitz, dessen Machtmissbrauch und Nötigung sie dokumentiert wissen möchte. Ein Untersuchungsausschuss gibt ihr 1991 in allen Punkten recht.
Abschied von der Oper
Im Sommer 1990 steht sie zum letzten Mal im Goethetheater Bad Lauchstädt bei einer Inszenierung des Theater Halle als Königin der Nacht auf der Bühne. „Ich war besonders gut an diesem Abend, wollte mir selbst einen würdevollen Abschied geben, denn niemand außer mir wusste davon.“ Sie hat diesen Entschluss bewusst gefasst, weil sie sich mehr um ihre Tochter kümmern möchte, die damals gerade elf Jahre alt ist. Hinzu kommt, dass sehr viele Theater neue, meist westliche, Intendanten haben. „Ich hätte da vorsingen müssen wie ein Anfänger – guten Tag, ich bin die Neue, ich komm jetzt öfter – neee. Also das war gegen meine Ehre.“
Nach der Wende werden die alten Hochschulstrukturen und somit die Stellen neu organisiert. Doch von ihrem Arbeitsplatz bei der Hochschule hängt ab, ob Renate ihre Tochter allein versorgen und ihr Haus weiter finanzieren kann. Dafür muss sie eine letzte berufliche Hürde nehmen und sich erneut bewerben, obwohl sie seit Jahrzehnten an der Hochschule beschäftigt ist. Als sie die ausgeschriebene Professorenstelle bekommt, ist sie sehr erleichtert. Endlich ist sie mit ihrer Tochter sozial abgesichert.
Renate liegt viel an ihren Schülern. Auch nach Jahren hält sie den Kontakt zu ihnen. Jedes Jahr veranstaltet sie eine Gartenparty in ihrem Haus in Berlin-Niederschönhausen – eine „Fête“ wie sie es nennt. „Es ist immer unterschiedlich, wer kommt, denn am Theater hast du ja nur zwei wirklich gesicherte Feiertage – Heiligabend und den ersten Mai.“ Es wird viel gesungen und die Ehemaligen tauschen ihre Erfahrungen über die unterschiedlichen Theater mit den aktuellen Schülern von Renate aus. „Das lieben alle immer sehr.“
Doch das allein reicht nicht. „Ein Sänger muss das innere Bedürfnis haben, seine Seele auf diese Art und Weise zu zeigen. Ich selbst bin nur der Verkehrspolizist – ich kann sagen, hier nicht und jetzt so und jetzt abbiegen, aber fahren muss jeder allein.“

Renate Faltin trifft man an der:
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
Charlottenstraße 55
10117 Berlin
Web: www.hfm-berlin.de
Renate Faltin kann man hier singen hören:
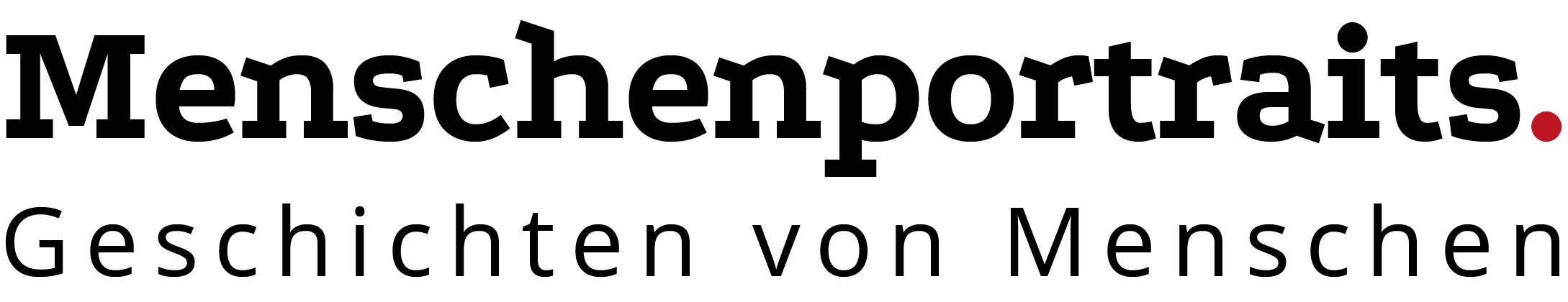















 Sein Atelier, in dem er in gefährlich schwankenden Stapeln seine Kunst aufbewahrt hatte, ist nur noch ein Trümmerhaufen. Über tausend Bilder hat er nicht unterstellen können, als er aufgrund der Räumungsfrist ausziehen musste. Sie wurden nun zerstört. Für jemanden, der kein einziges seiner Kunstwerke je weggeworfen hat, ist dies eine harte Probe. Da Petrus gerade eine dreijährige Ausbildung zum Altenpfleger begonnen hat, blieb ihm einfach keine Zeit, alles auszuräumen. „Ich stehe morgens um halb fünf auf, fahre zur Arbeit, arbeite acht Stunden oder mache Doppelschichten und habe auch noch ein Pferd, um das ich mich kümmern muss.“ Doch Petrus findet trotz allem, dass er es besser als andere hat: „Meine Kindheit war so Scheiße, dass mir die jetzige Situation leicht fällt, weil ich ja trainiert bin.“
Sein Atelier, in dem er in gefährlich schwankenden Stapeln seine Kunst aufbewahrt hatte, ist nur noch ein Trümmerhaufen. Über tausend Bilder hat er nicht unterstellen können, als er aufgrund der Räumungsfrist ausziehen musste. Sie wurden nun zerstört. Für jemanden, der kein einziges seiner Kunstwerke je weggeworfen hat, ist dies eine harte Probe. Da Petrus gerade eine dreijährige Ausbildung zum Altenpfleger begonnen hat, blieb ihm einfach keine Zeit, alles auszuräumen. „Ich stehe morgens um halb fünf auf, fahre zur Arbeit, arbeite acht Stunden oder mache Doppelschichten und habe auch noch ein Pferd, um das ich mich kümmern muss.“ Doch Petrus findet trotz allem, dass er es besser als andere hat: „Meine Kindheit war so Scheiße, dass mir die jetzige Situation leicht fällt, weil ich ja trainiert bin.“ Akkordeon fällt bereits in seiner Schulzeit mit ungewöhnlichen Aktionen auf. Ihn fasziniert, wie man Sichtweisen und dadurch die Realität verändert. Als 1990 sein Vater stirbt, will Akkordeon den Tod besser verstehen. Er bringt an einem Freitag einen großen Rinderknochen in die Schule und legt ihn in eine Glasvitrine der Kunst-AG in die Sonne. Die Vitrine schließt er ab. Am Montag zieht Verwesungsgeruch durch die Schule und die Lehrer sind empört. Akkordeon weigert sich eine Woche lang, die Vitrine wieder aufzuschließen. Er will unbedingt etwas sichtbar machen, was man sonst nicht sehen würde und nimmt dafür jeden Ärger in Kauf.
Akkordeon fällt bereits in seiner Schulzeit mit ungewöhnlichen Aktionen auf. Ihn fasziniert, wie man Sichtweisen und dadurch die Realität verändert. Als 1990 sein Vater stirbt, will Akkordeon den Tod besser verstehen. Er bringt an einem Freitag einen großen Rinderknochen in die Schule und legt ihn in eine Glasvitrine der Kunst-AG in die Sonne. Die Vitrine schließt er ab. Am Montag zieht Verwesungsgeruch durch die Schule und die Lehrer sind empört. Akkordeon weigert sich eine Woche lang, die Vitrine wieder aufzuschließen. Er will unbedingt etwas sichtbar machen, was man sonst nicht sehen würde und nimmt dafür jeden Ärger in Kauf.














Kommentare