Sabine Zinc
Sabine Zinc (56), sagt von sich, sie sei eine echte „Ostbraut“. Sie lacht für ihr Leben gern, obwohl sie nicht immer viel Grund dafür hatte. Ihre Mutter akzeptierte sie nicht, ihre Tochter bekam Krebs, eine Partnerschaft ging aufgrund von Alkohol auseinander, ihr Bruder starb. Heute ist sie glücklich verheiratet mit Jürgen und immer noch verliebt wie ein Teenager.
Wenn man Sabine glaubt, dann ist es Jürgen, der sie ständig zum Lachen bringt. Glaubt man Jürgen, dann verdankt er es Sabine, dass er nach vielen Jahren endlich wieder lachen kann. Auf jeden Fall ist das Lachen von Sabine ein Naturereignis. Sie lacht mit ihrem ganzen Körper, krümmt sich nach vorn, nach links und nach rechts. Dabei zieht sie Grimassen, kneift ihre dunkelbraunen Augen zusammen und wedelt mit den Händen als wolle sie verhindern, dass ihr Gegenüber noch mehr lustige Sachen sagt, weil sie keine Luft mehr bekommt. Wer dann in der Nähe steht, wird einfach mitgerissen von dieser fröhlichen Lawine, die jegliche schlechte Laune kompromisslos niederwalzt.
Sabine Zinc (gesprochen „Zinz“) wurde am 5. August 1961 in Hohen Neuendorf bei Berlin als Sabine Hänel geboren. Ihr Start in die Kindheit war alles andere als einfach, denn sie litt an einer Art Kinderlähmung und konnte nicht laufen. „Bis ich vier Jahre alt war, wurde ich in einem Kinderwagen geschoben. Im linken Bein habe ich heute noch vier tiefe Löcher von den Spritzen, die ich immer in dieselben Stellen bekommen habe.“
Trennung von der Familie
Doch nicht nur die Spritzen haben Narben hinterlassen, auch das Verhalten ihrer Eltern – vor allem das ihrer Mutter – hat sie bis heute tief verletzt. „Als ich anderthalb Jahre alt war, hat meine Mutter beschlossen, dass ich nicht in die Familie passe,“ sagt Sabine. Sie versteht bis heute nicht, weshalb die Mutter sie zu den Großeltern gibt, aber alle Geschwister später bei sich behält.
Der Kontakt zur Familie bleibt in den folgenden Jahren distanziert. Die beiden jüngeren Schwestern Verena, Daniela, die ältere Schwester Manuela und ihren Bruder Hilmar sieht sie nur bei Familienfesten. „Die wollten alle nichts mit mir zu tun haben, weil ich bei Oma wohnte“, sagt Sabine heute. Doch eine richtige Erklärung ist das nicht. Ihre Mutter reagiert extrem abweisend, wenn sie ihre Tochter durch Zufall in der Stadt trifft und wechselt sogar die Straßenseite. Das ist schwer zu verstehen und sicher nicht die beste Voraussetzung, um sich später selbst zu lieben. Doch glücklicherweise gibt es Sabines Oma. Diese sorgt dafür, dass Sabine trotz allem eine glückliche Kindheit hatte. Bei ihr findet sie das, was ihre Mutter ihr bis heute verweigert: Liebe und Fürsorge. „Meine Großeltern waren irgendwann meine Mama und mein Papa,“ sagt Sabine rückblickend und lächelt. Als ihr Opa stirbt, ist sie elf Jahre alt und wohnt danach weiter bei ihrer Oma „damit sie nicht so alleine ist“, wie sie sagt.
Liebe und Alkohol
Sabine bleibt in Hohen Neuendorf, macht eine Ausbildung zur Bäckerverkäuferin und Kassiererin im Großhandel und trifft ihren ersten Mann Rainer. Mit ihm ist sie 20 Jahre zusammen und zieht mit ihm ihre beiden Kinder Dominik (34) und Belinda (29) groß. Sabines Mutter bleibt weiter auf Abstand. Weder unterstützt oder besucht sie ihre schwangere Tochter, noch interessiert sie sich später für ihre Enkel. Sabine sagt, ihr selbst sei das egal gewesen, doch ihr Blick lässt daran zweifeln.
Nach der einvernehmlichen Trennung von ihrem Mann folgt eine langjährige Beziehung mit Volker, einem begnadeten Koch, aber leider auch einem Alkoholiker, Sabine merkt erst, wie es um ihn steht, als er nach einem gemeinsam verbrachten Abend eines Morgens vor ihr steht und sie anfährt, wo sie denn nachts gewesen sei. Volker beschuldigt sie, fremdgegangen zu sein und phantasiert, dass das Wohnzimmer voller fremder Männer sei. „Er hatte sich das Kurzzeitgedächtnis vollkommen weggesoffen.“ Volker hat das Korsakow-Syndrom – seine Gehirnzellen sind durch Alkohol unwiderruflich zerstört. „Ich habe nur von Bier gewusst, bis dann die Flachmänner aus den Ecken gepoltert sind. Du kannst dir nicht vorstellen, wo die überall waren. Er hatte zwar immer eine Fahne, aber er wirkte nicht betrunken. Ich habe das zwölf Jahre lang nicht gemerkt. Vielleicht wollte ich es auch nicht wahrhaben.“
Einige Zeit bleibt Sabine noch bei ihm, doch sein Zustand macht ein Zusammenleben schließlich unmöglich. Auf Bitten ihrer Tochter Belinda verlässt sie ihn und zieht 2010 zu ihr nach Berlin-Hohenschönhausen.
Sorge um die Tochter
Anders als sie es mit ihrer eigenen Mutter erlebt hat, hat Sabine ein sehr enges Verhältnis zu ihrer damals 23-jährigen Tochter. Sie liebt sie über alles und genießt das Zusammenleben mit Belinda, ihrem einjährigen Enkel Damion und seinem Vater sehr. Doch dann schlägt das Schicksal erneut zu. Im Februar 2011 entdeckt Belinda morgens beim Blick in den Badezimmerspiegel eine große Beule an ihrem Hals, die am Abend zuvor noch nicht da war. Sie gehen sofort zum Arzt. Der ist sehr alarmiert, entnimmt eine Gewebeprobe und schickt sie ein. Das Ergebnis ist ein Schock: Morbus Hodgkin, Lymphdrüsenkrebs.
Es beginnt eine Zeit, an die sich Sabine nicht gern zurückerinnert. Ihre Tochter wird operiert, bekommt Bestrahlung, dann Chemotherapie und muss verschiedene Medikamente nehmen. Sabine pflegt ihre Tochter und weicht ein Dreivierteljahr lang keinen Tag von ihrer Seite. Da Belindas 20-jähriger Freund von der Krankheit, aber auch von der Vaterrolle überfordert ist, kümmert sich Sabine auch um den Enkel. In dieser schweren Zeit hofft Sabine noch einmal auf das Verständnis ihrer Mutter. Sie ruft sie an und erzählt ihr von der Krebskrankheit ihrer Enkelin. „Da hat sie einfach gesagt, solange Belinda noch rumlaufen kann, wird es ja nicht so schlimm sein.“ Die Erinnerung daran macht Sabine immer noch wütend. „Ich habe dann nicht mehr mit meiner Mutter gesprochen.“
Belinda verliert durch die Krankheit stark an Gewicht und auch Sabine wird immer dünner aus Sorge um sie. „Das hatte den Vorteil, dass wir uns beide die gleichen Klamotten kaufen konnten,“ erinnert sich Sabine lachend. So zeigen sie, dass sie zusammengehören. Belinda geht später nach überstandener Krankheit noch einen Schritt weiter und lässt sich den Namen „Sabine“ auf den Arm tätowieren. Aus Liebe zu ihrer Mutter.
Es gibt ein Foto von Sabine, auf dem sie und ihre vier Geschwister mit ihrem Vater zu sehen sind. Sabine hat die kräftige Statur von ihm und auch den dunklen Teint, der viele glauben lässt, sie sei Türkin. „Dabei bin ich eine hundertprozentige Ostbraut“, sagt Sabine und grinst. Wenn es Sabine gut geht, umrandet sie ihre dunklen Augen mit schwarzem Kajal und zieht ihr Leoparden-T-Shirt an. Ihre langen Fingernägel lackiert sie sorgfältig mal schwarz, tiefrot oder mehrfarbig. Fingernägel sind wichtig, denn sie sind der Grund, weshalb sie heute zum zweiten Mal verheiratet ist. „Dabei habe ich immer gesagt, ich heirate nie wieder,“ sagt Sabine lachend.
Warum man mit langen Fingernägeln nicht Billard spielen sollte
Doch dann kam Jürgen. Sie kennt ihn schon seit Jahren als guten Freund, mit dem sie ab und zu quatscht oder Skat spielt. Mehr nicht. Als er sie also an einem Samstag anruft und fragt, ob sie Lust hätte, mit ihm Billard spielen zu gehen, denkt sie sich nichts weiter dabei. Sie macht sich hübsch und fährt spät abends nach Hohen Neuendorf. Sie spielen eine Weile, doch dann fällt einer ihrer aufgeklebten Fingernägel in das Loch, in das die Kugeln hinein sollen. Der Billardtisch ist blockiert, nichts hilft – den Nagel bekommen sie nicht mehr heraus. Jürgen sieht sie eine Weile an und sagt schließlich: „Na, wenn das hier so langweilig ist, können wir auch zu mir fahren – da ist es genauso langweilig.“
Sabine geht mit und bleibt gleich bis zum Frühstück. Später wird daraus das ganze Wochenende. „Und dann fing das Wochenende donnerstags an und hörte erst mittwochs auf. Irgendwann sagte dann meine Tochter: ’also wohnst du jetzt hier oder wohnst du da? Dein Enkel vermisst dich.“
Beide sind verliebt wie Teenager und überglücklich. Den Heiratsantrag macht dann Sabine spontan, als sie mit dem Auto an einer roten Ampel warten müssen. „Ich sagte zu meinem Liebling: ’weißte was, fahr am besten mal hier links rum zum Linden Center.“ Als Jürgen erstaunt fragt, was sie da noch kaufen möchte, antwortet Sabine kurz und knapp: „Ich kauf jetzt Ringe.“ Und als Jürgen wissen will, ob das ein Heiratsantrag war, sagt Sabine kichernd ‚ja‘. Ihren Jürgen heiratet sie am 23. Mai 2014 in Schöningen und feiert dann in kleinem Kreis in ihrer Gartenlaube. Auf dem Hochzeitsfoto steht das glückliche Brautpaar in strahlender Sonne vor dem geschmückten Auto. Jürgen hat seine langen Haare auf Wunsch von Sabine kurz schneiden lassen, aber sein vorwitziger grauer Schnauzer ist geblieben. Sabine hat blond gefärbte Haare und ein langes weißes, schulterloses Kleid mit Armstulpen aus Spitze. Ihr kleiner roter Brautstrauß passt perfekt zum roten Jackett von Jürgen mit den kleinen Ansteckblumen. Beide haben ihre Arme ineinander verschränkt und halten sich an den Händen, fest entschlossen, sich nie wieder loszulassen.
Der Tod gehört zum Leben dazu
Vor der Hochzeit hatte sich Sabine bereits in der Schöninger Region als Altenpflegehelferin beworben. Diese Zusatzausbildung hatte sie noch in Berlin absolviert, aber dort keine Arbeit gefunden. „In Berlin bekam ich immer die Ausrede, ich sei ja schon über 50. Irgendwann konnte ich das nicht mehr hören.“ Und nun ist sie in Schöningen und bekommt eine Woche nach ihrer Hochzeit nun auch eine neue Arbeitsstelle. „Das war Liebe auf den ersten Blick mit meiner Chefin.“
Für Sabine beginnen nun drei herausfordernde Jahre in einer Dementen-WG in Wolfsburg. Jeden Tag fährt sie von Schöningen 45 Kilometer hin und zurück, oft auch spätnachts über Land. Sie arbeitet zwei Schichten hintereinander, denn wie überall in der Pflege herrscht auch hier Personalmangel. Sabine liebt ihren Beruf. Hier ist sie genau richtig mit ihrer gefühlsbetonten und fürsorglichen Art. Sie liebt die Nähe zu den demenzkranken Menschen, die sie drücken und Dinge sagen wie „schön, dass du da bist.“ Auch, wenn sie vielleicht in diesem Moment denken, es sei ihre Enkelin, die vor ihnen steht. Sie begleitet Menschen oft bis zu ihrem Tod, lagert sie bequem und liest ihnen vor, bis sie nicht mehr atmen und weint auch um sie.
Doch all das hinterlässt auch seine Spuren. Immer seltener gelingt es Sabine, die Arbeitserlebnisse am Fahrstuhl zurückzulassen. Immer mehr zehren die vielen Schichten und die Nachtarbeit an ihren Ressourcen. Hinzu kommen zwei Autounfälle mit Wildtieren innerhalb von zwei Wochen, die sie verdrängt und trotz des Schocks danach weitermacht wie immer. Doch dann kommen plötzlich Panikattacken. Autofahren wird immer mehr zur Qual, und sie muss sich regelrecht zwingen, einzusteigen. Es wird schließlich so schlimm, dass sie eines Morgens einsehen muss, dass es nicht mehr geht. „Ich hab meinen Mann angeguckt und gesagt: ’ich kann nicht fahren. Ruf an und sag Bescheid“. Sabine nimmt sich notgedrungen eine Auszeit, will aber im Januar 2017 unbedingt wieder arbeiten gehen.
Doch dann kommt alles anders. Im Januar stirbt ihr Bruder Hilmar an einem Herzinfarkt auf Mallorca, und Sabine ist am Boden zerstört. An Arbeit ist nicht mehr zu denken. Sabine schluckt, als sie das erzählt, denn sie und ihr Bruder standen sich sehr nah. Ihre Liebe füreinander haben sie erst im Erwachsenenalter entdeckt, als Hilmar gegen den Willen der Mutter den Kontakt zu seiner Schwester wieder aufgenommen hatte. Da er jedoch auf Mallorca lebte, konnten sie sich nur selten sehen.
Der Tod ihres Bruders macht Sabine so sehr zu schaffen, dass sie sich überwindet und ihre Mutter anruft, weil sie mit ihr über ihren Bruder sprechen möchte. Das Gespräch wird zum Fiasko, weil es der Mutter nur darum geht, Geld für die Beerdigung einzufordern. Das ist zu viel für Sabine, die das Gespräch wütend abbricht.
Die Mutter bestimmt schließlich allein, wann und wie die Verbrennung stattfindet und wo die Asche ins Mittelmeer gestreut werden soll. Hilmar hatte sich eine Seebestattung gewünscht. Die Mutter informiert weder Hilmars Lebensgefährtin Susan,noch Sabine und lädt beide nicht zur Trauerfeier ein. Bis heute erträgt Sabine den Gedanken nicht, dass sie sich nicht von ihrem Bruder verabschieden konnte. Das ist der Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen bringt. „Das werde ich meiner Mutter niemals verzeihen. Zu ihrer eigenen Beerdigung werde ich nicht gehen.“
Die Angst überwinden
Seit dem Tod ihres Bruders geht es Sabine schlecht. Sie hat Angst in geschlossenen Räumen, kann keine längeren Strecken mehr mit dem Auto fahren und die alltäglichsten Dinge werden zur Herausforderung. Selbst eine Straße mit Kurve oder einer Steigung kann Panikattacken auslösen, weil Sabine nicht sehen kann, was hinter dem Hügel oder hinter der Kurve kommt. Sie ist deshalb krankgeschrieben und hat eine Reha gemacht, aber gut geht es ihr immer noch nicht.
Nur, wenn sie von ihrem Mann Jürgen spricht, ist ihr altes Strahlen wieder da. Man spürt die tiefe Liebe, die sie für ihn empfindet. Sie möchte es beschreiben, kann es aber gar nicht richtig in Worte fassen. „Mein Mann ist so liebenswürdig. Er ist lieb, der ist kuschelig, der – ich weiß es nicht,“ Sabine bricht ab und lacht aus vollem Herzen.
Solange er für sie da ist, wird sie das Lachen trotz aller Rückschläge nie verlernen. Vielleicht traut sie sich dann eines Tages sogar, mit dem Flugzeug nach Australien zu fliegen. Dort lebt seit sechs Jahren ihr Sohn Dominik mit seiner Frau, den sie nur sehr selten sehen kann. Das ist ein Herzenswunsch von ihr, den sie bislang nicht erfüllen konnte, zu stark ist ihre Angst, im Flugzeug eingeschlossen zu sein.
Was ihre Mutter betrifft, so hat Sabine ihr einen Brief geschrieben. Einen langen Brief, der all die Verletzungen aufführt, die sie durch sie erfahren hat. Sie erkennt ihr darin das Recht ab, sich „Mutter“ oder „Oma“ zu nennen. Denn das war sie nie. Der Brief ist der Schlussstrich einer Beziehung, die nie wirklich existiert hat. „Mir geht es seitdem deutlich besser,“ sagt Sabine. Die Frau, die früher ihre Mutter war, braucht sie schon lange nicht mehr.

Sabine Zinc trifft man in Schöningen bei Helmstedt oder auf Facebook.
Immer dabei: ihr Mann Jürgen (ein echter Hohen Neuendorfer) und Hund „Uschi“ (ein „reinrassiger“ Pudel-Malteser-Mix).
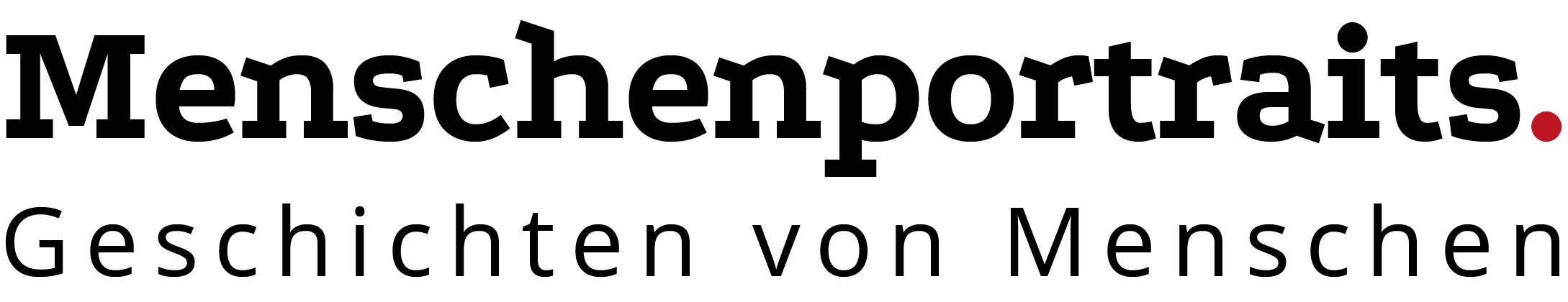






Kommentare